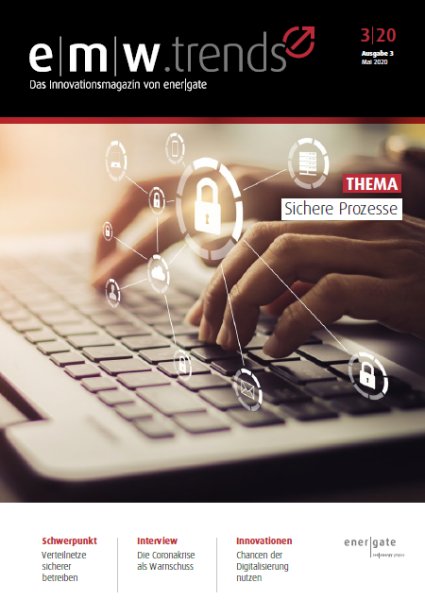Die Coronakrise hat alte Gewissheiten über den Haufen geworfen. In manchen Bereichen hat sie den Anstoß gegeben, neue Wege tatsächlich zu beschreiten, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Und auch für die Energiewirtschaft wirft die Krise wirft viele Fragen auf: Wie krisensicher ist etwa unsere Energieversorgung? Über die Frage, ob dezentrale Energiesysteme uns resilienter gegen Blackouts machen, sprach ener|gate-Redakteurin Nabila Lalee mit Jens Strüker, Professor am Institut für Energiewirtschaft (INEWI) an der Hochschule Fresenius.
e|m|w.trends: Herr Strüker, kann eine dezentrale Energiewelt die Wahrscheinlichkeit eines flächendeckenden Blackouts verringern?
Strüker: Ja, ein integriertes dezentrales System kann grundsätzlich sehr widerstandsfähig gegen Gesamtausfälle sein.
Hintergrund ist insbesondere, dass bei zentralen Systemen häufig ein sogenannter Single Point of Failure vorliegt. Hierbei kann der Ausfall von beispielsweise wenigen Kraftwerken oder einer Übertragungsleitung den Zusammenbruch des gesamten Stromnetzes nach sich ziehen.
Um dies zu verhindern, müssen teure Redundanzen im System vorgehalten werden, sodass jedes wesentliche Element im System ausfallen kann. Das spiegelt sich im heutigen Stromsystem im geltenden N-1-Prinzip wider. Bei dezentralen Systemen hingegen führt der Ausfall von Erzeugungsanlagen nicht unmittelbar zu einem Gesamtausfall, da andere Erzeugungsanlagen, Lasten oder Speicher die ausgefallenen Anlagen ersetzen beziehungsweise ausgleichen können.
#