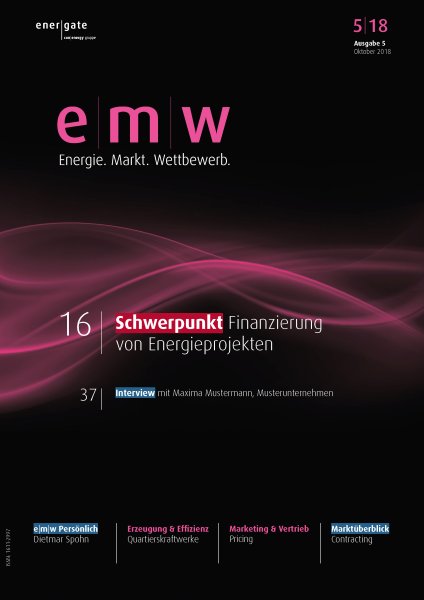Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz ändern sich auch die Betriebsweisen fossil betriebener Kraftwerke. Damit einher gehen neue Anforderungen an die Werkstoffe. Ein Forschungsvorhaben in einem Großkraftwerk in Süddeutschland untersuchte den Einsatz von Rohrleitungs- und Armaturenbauteilen aus Nickelbasislegierungen.
Der Einsatz dieser Hochtemperaturwerkstoffe erfordert neue Instandhaltungs- und Prüfkonzepte.
Im ersten Halbjahr 2018 überstieg der Anteil des bundesweit erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien erstmals die Produktionsmenge der Kohlekraftwerke. Die Bedeutung der Kohlekraft hat das allerdings nicht geschmälert. Noch immer liefern die Anlagen rund ein Drittel des in Deutschland benötigten Stroms. Außerdem sind sie nicht wegzudenken, um auftretende Residuallasten durch die fluktuierende Einspeisung der Erneuerbaren auszugleichen. Darüber hinaus muss der Netzausbau beschleunigt werden, um die erneuerbaren Energien zu integrieren. Dafür fehlen momentan noch die wirtschaftlichen Anreize. Auch die Frage nach einer Alternative zur Kohlekraft, um schwankende Einspeisungen künftig zu decken, ist noch nicht geklärt.
Das Kraftwerk der Zukunft
Kontinuierlicher Betrieb unter Volllast: Dieser Modus hat ausgedient. Klimatische Begebenheiten wie Sturmtiefs, Windflauten oder Sonnenstunden beeinflussen die eingespeiste Strommenge aus erneuerbaren Energien. Je nach Situation müssen fossil betriebene Kraftwerke ihren Betrieb auf ein Minimum reduzieren (Niedriglastfahrweise, bspw. im Ein-Mühlen-Betrieb) oder – im Falle entstehender Residuallasten – schnell hochfahren, damit eine flächendeckende Stromversorgung gewährleistet ist. Gefragt sind deshalb Anlagen, die eine hohe Lastwechselflexibilität aufweisen und steile An- und Abfahrgradienten bei Kalt- und Warmstart bewältigen. Damit verbunden sind Anpassungen an der Leittechnik und möglichst geringe Überwachungs- und Instandsetzungsaufwände. Ein weiteres Augenmerk liegt auf gesenkten Emissionen.
#