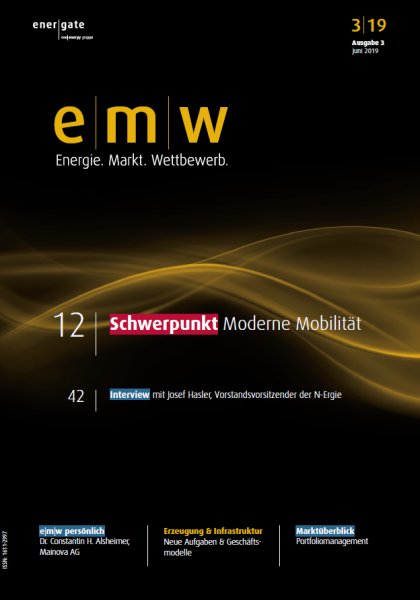Auch kleine Kraftwerke werden im Zuge der Energiewende zukünftig fundamental anders funktionieren müssen. Ihre Verbrauchernähe ist günstig für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Für lokale Energieversorger ergeben sich daraus gleich mehrere Potenziale: die Flexibilisierung vorhandener KWK-Anlagen mit marktoptimierter Stromeinspeisung, der Auf- oder Ausbau von Wärmenetzen und der effiziente Netzbetrieb mit optimierten vertikalen Lasten.
Gerade Stadtwerke können damit mehr Geld verdienen.
Die Arbeitspferde der Energiewende sind die erneuerbaren Energiequellen Wind und Sonne. Fortschritte bei der Energieeffizienz vorausgesetzt, kann mit etwas mehr als dem Vierfachen der heute installierten Leistung der gesamte inländische Strombedarf einschließlich der Elektromobilität gedeckt werden.
Doch das gilt nur mengenmäßig, bilanziell. Grundsätzlich hapert es bei der Gleichzeitigkeit von Angebot und Nachfrage, selbst wenn die stetigere Erzeugung aus in Meereswindparks erzeugtem Strom deutlich intensiver genutzt wird. Schon bei 65 Prozent Erneuerbaren-Strom, die 2030 erreicht sein sollen, zeigen Simulationen im deutschen Netz an etwa 3.000 Jahresstunden volle Deckung oder ein Überangebot – und eine umso größere Unterdeckung in der übrigen Zeit. Bei einer nochmaligen Verdoppelung der erneuerbaren Einspeisung würde zwar in über 6.000 Stunden der Bedarf gedeckt, aber in mehr als 2.000 Stunden im Jahr genügt die Einspeisung eben nicht. Es bleibt eine Residuallast von bis zu etwa 50 Gigawatt.
#