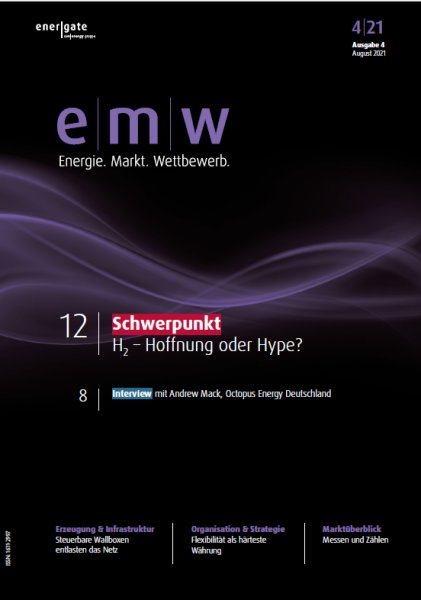Die Wärmewende stellt die Betreiber von Fernwärmesystemen technisch und ökonomisch vor große Herausforderungen. In der Vielzahl an Möglichkeiten sowohl auf Erzeugungs- als auch auf Abnahmeseite die beste und zukunftssicherste Lösung für das eigene System zu finden, scheint schwierig.
Wie kann man diejenigen Maßnahmen identifizieren und absichern, die wirklich sinnvoll sind zum schrittweisen Umbau eines bestehenden Fernwärmesystems? Mathematische Optimierungssysteme zeigen passende Wege auf.
Der energiepolitische Diskurs in Deutschland war in den letzten beiden Jahrzehnten stark auf den Umbau des Stromerzeugungssystems fokussiert. Die Energiewende war und ist im öffentlichen Diskurs im Wesentlichen eine "Stromwende", obwohl auf elektrische Energie nur rund 20 Prozent des Endenergiebedarfs in Deutschland entfallen. Die Umstellung des Wärme- und Verkehrssektors auf CO2-ärmere Energieträger wird die Gesellschaft vor weit größere Herausforderungen stellen als die Umstellung des Stromsystems.
In Deutschland gibt es über 3.000 Fernwärmenetze, die etwa 14 Prozent der für die Beheizung von Wohnungsbestand benötigten Wärme liefern. 85 Prozent dieser Wärme stammen aus Kraft-Wärme-gekoppelten Systemen. Der Anteil von erneuerbaren Quellen liegt in diesem Sektor bei etwa 18 Prozent, die sich etwa hälftig auf die Nutzung von Biomasse und die Verbrennung von biogenem Siedlungsabfall verteilen. Nur rund 1 Prozent der heute genutzten Wärme stammt aus Geo- und Solarthermie.
#